Lerntechniken und Lernstrategien
Während Ihrer Ausbildung sammeln Sie viele Informationen und Eindrücke.
Damit diese nicht mit der Zeit verblassen, benötigen Sie effiziente Lerntechniken
und Lernstrategien. Wenn Sie den Stoff strukturiert aufarbeiten, können Sie sich mit
einem guten Zeitmanagement entspannt auf Ihre Prüfungen vorbereiten.
Artikel erschienen im Juni 2025
AutorInnen: Britta Blottner, Sebastian Degenhardt
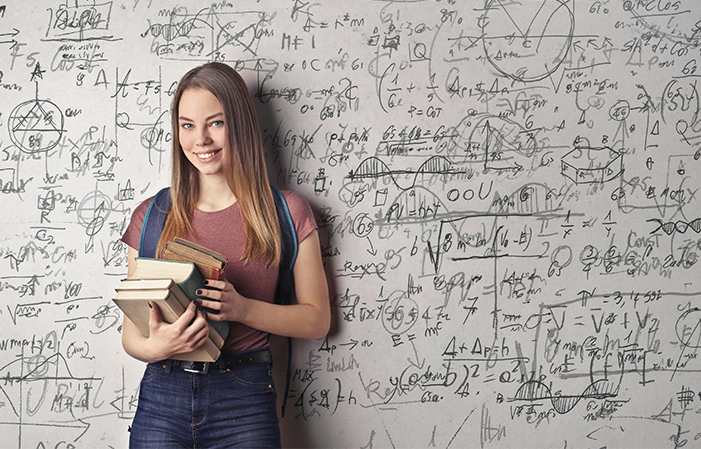
© Pexels; Andrea Piacquadio; 3768126
Während Sie sich in Ihrer Schulzeit „nur“ auf die Schule konzentrieren mussten, haben Sie in der Ausbildung zusätzlich zum Berufsschulunterricht die praktische Tätigkeit im Ausbildungsbetrieb. Hinzu kommen private Verpflichtungen, Hobbys und natürlich wollen Sie auch Zeit mit Freunden verbringen. Da wünschen sich manche, dass der Tag mehr als 24 Stunden hätte, um noch Zeit und Muße zum Lernen zu finden. Tatsächlich fällt es vielen Auszubildenden insbesondere in den ersten Monaten schwer, mit dem erhöhten Pensum klarzukommen. Die Woche so zu strukturieren, dass die Work-Life-Balance stimmt, wird zur Herausforderung.
Ein häufiger Fallstrick in solchen Situationen ist Prokrastination (vom lateinischen procrastinatio: Aufschub, Vertagung). Sie stehen vor einem großen Berg an Aufgaben und wissen nicht, mit welcher Sie beginnen sollen. Vielleicht erledigen Sie dann zunächst die einfachen und angenehmen Aufgaben, sodass die schwereren und missliebigen übrig bleiben. Sich dann zu motivieren, fällt natürlich schwer. Man lenkt sich mit anderen Dingen ab, bis die unerledigten Aufgaben nicht rechtzeitig zu schaffen sind. Es bleibt das Gefühl, versagt zu haben, was im Wiederholungsfall schwere psychische Probleme nach sich ziehen kann.
Bezogen auf das Lernen sieht das so aus: Der Prüfungstermin rückt immer näher und der Berg an Lernstoff erscheint unüberwindbar. Anstatt dieses Problem gezielt und organisiert anzugehen, wird Zeit mit nebensächlichen Dingen verplempert. Viele versuchen dann, wenige Tage vor der Prüfung das Wichtigste auswendig zu lernen, und scheitern erwartungsgemäß. Nach mehreren erfolglosen Prüfungen kann sich Prüfungsangst entwickeln, die sich auf sämtliche Prüfungssituationen negativ auswirkt. Dazu gehören auch Präsentationen vor Kolleg:innen oder Kund:innen. Die Betroffenen gehen bereits mit dem Glaubenssatz in diese Situationen, dass sie ohnehin kein gutes Ergebnis abliefern werden, egal wie sie sich vorbereiten. Es fehlt das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also das Bewusstsein, aus eigener Kraft einen Erfolg erzielen zu können.
Manche behelfen sich mit leistungssteigernden Mitteln, die das Lernen vereinfachen oder die Konzentration erhöhen sollen. Dazu gehören „bestenfalls“ koffeinhaltige Pillen oder Getränke als Wachmacher sowie Vitaminpräparate oder Tees mit zweifelhafter Wirkung. Manche greifen jedoch auch zu Mitteln gegen AD(H)S, Antidepressiva als Stimmungsaufheller oder gar Amphetaminen. Solche Präparate dürfen nur nach ärztlicher Anweisung eingenommen werden. Unter der Hand verkaufte Präparate verstoßen sehr wahrscheinlich gegen das Betäubungsmittelgesetz. Oft ist auch nicht klar, was sie enthalten. Neben schweren gesundheitlichen Schäden drohen dann juristische Konsequenzen. Selbst die Bestnote in einer wichtigen Prüfung wiegt dieses Risiko nicht auf.
Um den Teufelskreis aus Misserfolgen und Prüfungsangst zu durchbrechen, bieten manche Schulen mittlerweile im Rahmen der Schulsozialarbeit Beratung und Lerncoaching an. Wenn Sie Zugang zu einem solchen Angebot haben, scheuen Sie sich nicht, es anzunehmen. Das Lerncoaching sollte dabei nicht mit Nachhilfe verwechselt werden. Während bei der Nachhilfe inhaltliche Fragen geklärt und Aufgaben gelöst werden, die im Unterricht nicht verstanden wurden, geht es beim Lerncoaching um die Vermittlung von Methoden zur Selbstorganisation. Wird in Ihrem Umfeld kein Lerncoaching angeboten, können Sie sich mit Lernstrategien, Lerntechniken und Methoden des Zeitmanagements selbst behelfen.
Lerntechniken und -strategien
Lernen sollte strukturiert und zielgerichtet ablaufen. Es macht zum Beispiel wenig Sinn, den Unterrichtsmitschrieb einfach auswendig zu lernen oder seitenlange Texte im Lehrbuch immer wieder komplett durchzulesen, wenn davon vielleicht nur ein Drittel relevante Informationen enthält. Ebenso bringt es nachweislich nichts, sich Kurzvideos anzuschauen, ohne sich danach eingehend mit dem Erklärten auseinanderzusetzen. Denn beim Konsum von Lernmedien befindet sich das Gelernte lediglich im Kurzzeitgedächtnis. Damit es ins Langzeitgedächtnis übergeht und dann auch in der Prüfung abrufbar ist, müssen Sie den Stoff mehrfach wiederholen und in Form von Aufgaben oder Praxisbeispielen durchdenken.
Zunächst einmal sollten Sie daher das, was im Unterricht beziehungsweise Ausbildungsbetrieb behandelt wurde oder was Ihnen in Form von Lernmedien zur Verfügung steht, auf den für Sie wichtigen Teil herunterbrechen. Erstellen Sie kurze Zusammenfassungen (Exzerpte), in denen Sie nur die relevanten Informationen zusammenfassen. Dabei sind Diagramme, Zeichnungen oder Stichwortlisten besser als Fließtext. Um sich eine Übersicht über ein Thema zu verschaffen, können Sie beispielsweise eine Mindmap erstellen. Dabei sammeln Sie alle Stichpunkte, die Ihnen zu einem Thema einfallen. Die Mindmap kann mehrere Ebenen enthalten, sodass ein ganzer Baum von Schlagwörtern entsteht.
Quelle: Eigene Darstellung
Wenn Sie längere Texte als Lernmedien verwenden, sollten Sie folgende Lesetechnik verwenden:
- Überfliegen Sie die Überschrift, Zwischenüberschriften, Überschriften von Abbildungen und Tabellen. Falls vorhanden, können Sie auch fett, kursiv oder farbig markierte Begriffe sowie Randnotizen (Marginalien) berücksichtigen.
- Formulieren Sie Fragen, auf die Sie sich beim Lesen des Textes eine Antwort erhoffen. Das können Sie mündlich oder schriftlich machen. Wichtig ist, dass Sie sich selbst auf das Lesen einstimmen und dadurch motivieren.
- Nun beginnen Sie damit, den Text Absatz für Absatz intensiv zu lesen. Markieren Sie mit Textmarker oder Buntstiften nur wichtige Begriffe oder kurze Erklärungen, keinesfalls ganze Absätze. Wenn Sie mit einem PDF-Dokument arbeiten, nutzen Sie die Annotationsfunktionen des PDF-Readers.
- Halten Sie nach jedem Absatz kurz inne und überlegen Sie sich, ob darin die Fragen beantwortet wurden, die Sie in Schritt 2 formuliert haben. Diese Erkenntnisse kommen dann ins Exzerpt.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Exzerpt zu umfangreich geworden ist, schreiben Sie ein Exzerpt dieses Exzerptes. Allein das ist bereits eine Wiederholung, bei der Sie sich intensiv mit dem Stoff auseinandersetzen. Nach und nach kristallisiert sich beim Exzerpieren das Wesentliche heraus, das Sie dann in einer Übersicht ablegen können, zum Beispiel als Lernkarte (Flash Card) in einer Lernkartei.
Wichtig ist, dass Sie Exzerpte selbst erstellen. Zusammenfassungen von Mitschüler:innen oder aus dem Internet können Sie zum Abgleich mit Ihren eigenen verwenden. Sie ersetzen nicht die Beschäftigung mit dem Stoff. Denn viele Informationen, die zum Verständnis nötig sind, sind darin nicht enthalten. Sinnvoll sind dagegen der Austausch mit anderen in einer Lerngruppe, gegenseitiges Abfragen und das Diskutieren von Anwendungsfällen. Dabei merken Sie schnell, in welchen Themen Sie sich sicher sind und wo Sie gegebenenfalls noch Klärungsbedarf haben. Den können Sie dann in der Schule oder dem Ausbildungsbetrieb ansprechen.
Eine selten verwendete, aber sehr effektive Methode ist das Führen eines Lerntagebuchs. Ein Tagebuch dient dazu, Revue passieren zu lassen, was den Tag über erlebt wurde und das in eigenen Worten niederzuschreiben. Beim Lesen des Tagebuchs werden Erinnerungen wachgerufen, die längst ins Unterbewusstsein gerutscht sind. Analog dient ein Lerntagebuch dazu, besondere Erlebnisse oder Erkenntnisse zu verarbeiten und zu dokumentieren, die im Unterricht, bei einer Schulung oder auch einfach im Alltag einen Lerneffekt bewirkt haben. Sie können als Lerntagebuch beispielsweise ein Heft oder eine Kladde verwenden. Kladden gibt es mit schön gestaltetem Einband. Das erhöht die Motivation, damit zu arbeiten. Natürlich können Sie das Tagebuch auch digital führen. Eine mögliche Struktur für einen Tagebucheintrag wäre die Beantwortung folgender Fragen:
- Was habe ich heute gelernt?
- Was war daran neu für mich?
- Wie könnte ich das anwenden?
- Wie habe ich das gelernt/verstanden?
- Was habe ich nicht verstanden?
- Wie gehe ich vor, um es zu verstehen?
- Was will ich darüber hinaus wissen?
Die meisten gängigen Lernmedien vermitteln Informationen über die Augen (visuell) oder Ohren (akustisch). Je nach Thema lassen sich Inhalte auch durch Ausprobieren oder in Kombination mit Bewegung vermitteln (haptisch bzw. motorisch). Vielleicht haben Sie eine besondere Präferenz bei der Auswahl von Lernmedien. Da ein Mensch seine Umwelt im Durchschnitt zu 70 Prozent über die Augen wahrnimmt, bevorzugen viele visuelle Lernmedien. Videos sind audiovisuell, sprechen also gleich zwei Sinne an, und sind daher sehr beliebt. Allerdings besteht die Gefahr, dass zu viele Reize im Video vom eigentlichen Inhalt ablenken.
Gemäß der Präferenz wurde früher versucht, Lernende in visuelle, akustische oder motorische Lerntypen einzuteilen. Damit war dann die Empfehlung verbunden, sich möglichst über den bevorzugten Kanal mit Informationen zu versorgen, um den Lernprozess zu erleichtern. Neueren Erkenntnissen zufolge können die meisten Menschen aber mit allen Lernmedien arbeiten. Wichtiger ist vielmehr, dass das Medium zum Lernziel beziehungsweise zur Lernstrategie passt. Medienwechsel innerhalb einer Lerneinheit können hilfreich sein. Stehen zu einem Thema verschiedene Lernmedien zur Verfügung, probieren Sie einfach aus, womit Sie am besten arbeiten können.
Zeitmanagement
Wenn Sie eine Prüfung mit viel Stoff oder mehreren Themengebieten vor sich haben, besteht die Gefahr, sich zu verzetteln. Um den Überblick zu behalten, können Sie ein Kanban-Board erstellen. Die Methode stammt aus dem agilen Projektmanagement und dient dazu, komplexe Aufgaben auf Teilaufgaben herunterzubrechen, die nach und nach abgearbeitet werden. Auf einem Kanban-Board gibt es drei Spalten, um zu visualisieren, welche Teilaufgaben noch zu erledigen sind, welche aktuell bearbeitet werden und welche bereits abgeschlossen sind.
Quelle: Eigene Darstellung
Übertragen auf eine Prüfungsvorbereitung bedeutet das: Sie untergliedern den Prüfungsstoff zunächst in überschaubare Lernaufgaben (Learning Nuggets) und schätzen ab, wie viel Zeit dafür jeweils benötigt wird. Für jede Lernaufgabe beschriften Sie einen Klebezettel, der in die linke Spalte des Kanban-Boards geklebt wird. Ist die Aufgabe in Bearbeitung, wandert der Zettel in die mittlere Spalte. Themen, bei denen Sie sich sicher fühlen, kommen in die rechte Spalte. Von da aus können Sie sie bei Bedarf auch jederzeit wieder weiter nach links ziehen, also erneut bearbeiten. Mit dem Kanban- Board haben Sie immer den aktuellen Stand der Prüfungsvorbereitung vor Augen.
Unterschiedlich farbige Klebezettel oder Markierungen können die Priorität einer Lernaufgabe widerspiegeln. Verbleibt nur noch wenig Zeit, dann lernen Sie vorrangig die Themen mit hoher Prüfungsrelevanz. Erst dann nehmen Sie sich die Lernaufgaben mit mittlerer und niedriger Priorität vor. Kanban-Boards gibt es auch als Programme oder Apps.
Wenn Sie mit dem Kanban-Board visualisiert haben, was Sie lernen wollen, müssen Sie planen, wann Sie das tun. Grundsätzlich gilt: Fangen Sie so früh wie möglich an, damit Sie ausreichend Zeit zur Planung und Durchführung haben. Dazu nehmen Sie sich einen Kalender und verschaffen sich einen Überblick über die Tage zwischen heute und der Prüfung. Tragen Sie darin alle absehbaren Termine ein, zu denen Sie definitiv keine Zeit haben. Dann blocken Sie sich Zeiten, zu denen Sie gut lernen können, und Zeiten, in denen Sie Pausen brauchen oder Freizeitaktivitäten nachgehen wollen. Diese Blöcke für Lern- und Freizeit sollten Sie nicht leichtfertig opfern oder vertauschen, denn Sie geben der Woche Struktur. Wenn Sie während den Lernphasen konzentriert arbeiten, können Sie in den Freizeitphasen mit gutem Gewissen entspannen und sich damit selbst belohnen, was die Motivation erhöht.
Nun müssen Sie die Lernaufgaben auf dem Kanban-Board entsprechend der dafür veranschlagten Bearbeitungszeit auf die Lernzeiten im Kalender verteilen. Planen Sie dabei auch Zeit zum Wiederholen ein. Insbesondere in der Zeit kurz vor der Prüfung sollte kein neuer Stoff bearbeitet werden.
Wochenplanung
| Tag | Zeit | Thema/Anmerkung |
|---|---|---|
| Mo | 17–19 | Anlagemöglichkeiten auf Konten |
| Di | – | Geburtstagfeier von Oma |
| Mi | 17–19 | Verfügungsberechtigungen |
| Do | 17–18 | staatliche Fördermöglichkeiten |
| Fr | 18–19 | Wiederholung Datenschutz und Datensicherheit |
| Sa | 09–11 | digitaler Nutzung von Konten |
| 13–15 | Sport | |
| 15–17 | AGB | |
| So | 09–11 | Wiederholung Anlagemöglichkeiten auf Konten |
Quelle: Eigene Darstellung
Meistens ist die Zeitplanung nicht von Anfang an perfekt. Während es bei manchen Themen „flutscht“, verläuft das Lernen anderer Themen zäher als gedacht. Sie können die Planung flexibel anpassen. Wichtig ist, dass Sie mit dem Kalender stets die verfügbare Zeit und die benötigte Zeit im Auge behalten.
Es ist sehr individuell, wann ein Mensch am besten lernen beziehungsweise arbeiten kann. Eine durchschnittliche Leistungskurve hat ein erstes Leistungshoch am Vormittag und ein zweites am Nachmittag. An dieser Kurve orientieren sich Unterrichtszeiten in Schulen und Arbeitszeiten im Ausbildungsbetrieb. Zahlreiche Menschen haben aber einen anderen Biorhythmus. Sie können für sich eine individuelle Leistungskurve erstellen und die Lernzeiten entsprechend legen.
Quelle: Eigene Darstellung
Pausenzeiten sollten als solche genutzt werden. Nachrichten lesen, soziale Medien nutzen oder Videos schauen bietet den Augen und dem Gehirn keine Entspannung. Besser sind ein gesunder Snack und etwas Bewegung an der frischen Luft. Auch eine kurze Yoga-Einheit als Ausgleich zum langen Sitzen kann sich positiv auswirken.
Selbst- und Zeitmanagement erfordern Übung. Es ist nicht einfach, jahrelang praktizierte Handlungsmuster abzulegen, selbst wenn man sich bewusst ist, dass sie in die falsche Richtung (Prokrastination, Prüfungsangst etc.) führen. Geben Sie also nicht auf, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert. Jede Prüfung bietet die Chance, es ein bisschen besser zu machen. Wenn dabei das Gefühl der Selbstwirksamkeit entsteht, geht es ganz von selbst.
Ergänzende Informationen und Materialien
Sie wollen mehr zum Thema erfahren? Dann empfehlen wir Ihnen aus der „Bankfachklasse" folgende Inhalte:
- Podcast „Selbstwirksamkeit in der Ausbildung"
- Beitrag „Lernen: Nachhaltig Wissen aneignen”
- Beitrag „Kreativität: Mit guten Ideen mehr erreichen”
- Beitrag „Work-Life-Balance: Ausgeglichen durch den Arbeitsalltag”
- Beitrag „Stressprävention: Die Arbeitsbelastung im Griff haben”
„Bankfachklasse“ abonnieren
Sie wollen alle Angebote der „Bankfachklasse“ nutzen? Hier finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Abonnements und unseren Bestellschein.
